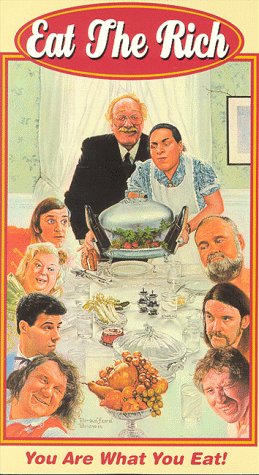Problem Nummer 1: Übergewicht
OECD-Studie
Jeder zweite Bürger ist übergewichtig
Fettleibigkeit nimmt in den OECD-Ländern immer mehr das Ausmaß einer Volkskrankheit an, Experten sind alarmiert. Besonders Kinder sind betroffen.
Durchschnittlich die Hälfte der Bürger in den Mitgliedsstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) ist übergewichtig. Deutschland ist in dieser Beziehung repräsentativ: Dort trugen zuletzt 60 Prozent der Männer und 45 Prozent der Frauen zu viele Kilos mit sich herum. Rund jeder sechste Deutsche war fettleibig. Vor 1980 habe der Anteil der krankhaft dicken Menschen in den meisten Ländern noch deutlich unter zehn Prozent gelegen, schreiben OECD-Experten.
Gründe für die ungesunde Entwicklung gibt es den Forschern mehrere: Ernährungsgewohnheiten, Stress und zu wenig Bewegung führen zum Übergewicht. Auch Kinder sind immer stärker betroffen. Schon jetzt ist den Zahlen zufolge jedes dritte Kind in den 33 OECD-Ländern übergewichtig.
"Schwer fettleibige Menschen sterben etwa acht bis zehn Jahre früher als Personen mit normalem Gewicht, und sie entwickeln mit höherer Wahrscheinlichkeit Krankheiten wie Diabetes, Herz-Kreislauf- Erkrankungen und Krebs", warnen die Experten.
Im Umgang mit dem Problem fordern sie eine gemeinsame Strategie von Regierungen und Wirtschaft. Fettleibigkeit könne bereits mit einem Aufwand von wenigen Euro pro Kopf erfolgreich bekämpft werden, heißt es.
Nach Definition der Weltgesundheitsorganisation WHO gelten Erwachsene mit einem Body-Mass-Index (BMI) zwischen 25 und 30 als übergewichtig und Personen mit einem BMI von über 30 als fettleibig. Der BMI berechnet sich aus dem Gewicht geteilt durch die Körpergröße zum Quadrat. Er gibt damit das Gewicht einer Person im Verhältnis zur Körpergröße an.
(Die Zeit, 23.9.10)
Problem Nummer 2: Hunger
UNO: Kampf dem Hunger
Erstmals seit Beginn der Erfassungen im Jahr 1970 hungerten 2009 mehr als eine Milliarde Menschen. Im ablaufenden Jahr starben wieder Millionen Männer, Frauen und Kinder an Unterernährung.
Rund 1,4 Milliarden Menschen leben in extremer Armut; sie müssen mit weniger als 1,25 US-Dollar am Tag über die Runden kommen. „Die Weltgemeinschaft kann den Armen und den Schwachen nicht den Rücken zuwenden“, mahnt Uno-Generalsekretär Ban Ki Moon. Auf der Agenda der internationalen Politik rückt der Kampf gegen die Armut immer weiter nach oben. Die Uno will im September 2010 in New York eine Zwischenbilanz im Kampf gegen die Not ziehen. Im Jahr 2000 versprachen die Staats- und Regierungschefs, bis 2015 die Verelendung der Erde zurückzudrängen.
Doch die Armut verschärft sich wieder – nachdem die Zahl der Habenichtse seit Beginn der 90er Jahre weltweit gesunken war. Hauptursache: Die globale Rezession. „Es wird geschätzt, dass im Jahr 2009 zwischen 55 und 90 Millionen Menschen zusätzlich in die extreme Armut getrieben werden“, heißt es in einem Uno-Papier. Auch Konflikte, Korruption und der Klimawandel machen die Fortschritte auf dem Weg zu einem besseren Leben für alle zunichte. Besonders hart trifft es die Menschen im Süden des Planeten: Von den Favelas Lateinamerikas über die Dürregebiete Afrikas bis zu den verstopften Slums im südlichen Asien zieht sich ein Gürtel der Hoffnungslosigkeit. Und ausgerechnet in diesen Gebieten werden sich aufgrund der hohen Geburtenraten immer mehr Menschen drängen. Nach Uno-Schätzungen steigt die Weltbevölkerung von derzeit rund 6,8 Milliarden Personen auf über neun Milliarden Personen bis 2050.
Um die Massen mit Lebensmitteln zu versorgen, verlangt die Uno-Landwirtschafts- und Ernährungsorganisation (FAO) massive Investitionen in kleine Agrarbetriebe der armen Länder. Rund 85 Prozent aller Landwirte haben kleine Höfe mit weniger als zwei Hektar Land – etwa zwei Milliarden dieser Kleinbauern produzieren Nahrungsmittel. Rund 44 Milliarden US-Dollar jährlich müssten die Regierungen für die Investitionen aufbringen. Zunächst hatte die FAO gehofft, dass die Politiker der reichen Staaten auf dem Welthungergipfel im November in Rom den Betrag zusagen würden. Doch die Kassen des Nordens blieben geschlossen. Stattdessen gab es eine wohlfeile Abschlusserklärung ohne bindende Verpflichtung. „Mit Vorsätzen ernährt man keine Milliarde hungernde Menschen“, kritisierte die Hilfsorganisation Oxfam.
Dass ausreichende finanzielle Mittel gepaart mit einer durchdachten Strategie Erfolge bringen, belegt die FAO an den Beispielen Armenien, Brasilien und Nigeria. In Armenien führte die Regierung 1998 eine Politik zur Stärkung des Privatsektors ein: Experten schulten Bauern in Bereichen wie Technik und Management, die Landwirte erhielten auch einen besseren Zugang zu Krediten. Die gezielte Förderung der Agrarbetriebe in der Ex-Sowjetrepublik trug wesentlich zu einem Etappensieg im Kampf gegen Armut und Hunger bei: Zwischen 1991 und 2005 schrumpfte die Zahl der Unterernährten um 60 Prozent.
Auch in Nigeria setzt die Regierung seit 2001 auf eine nachhaltige Förderung der Landwirtschaft; in dem bevölkerungsreichsten Land Afrikas arbeiten 70 Prozent der Erwerbstätigen im Agrarsektor. Fachleute unterrichten Kleinbauern, wie sie vom Anbau nur einer Frucht auf den Anbau von drei Früchten umsteigen. Der Erfolg trat ein: In Nigeria sank der Anteil der Unterernährten von 15 Prozent im Jahr 2001 auf acht Prozent im Jahr 2005. Brasiliens Regierung startete 2003 ihre nationale Kampagne gegen den Hunger: Die Ärmsten erhalten unter Auflagen finanzielle Mittel. Volksküchen versorgen die Einkommensschwachen und eine Aufklärungsaktion weist auf die Vorteile gesunder Nahrung hin. Zudem gibt die Regierung kleinen Farmern Abnahmegarantien für ihre Produkte. Tatsächlich sank auch in Brasilien der Anteil der Unterernährten zwischen 2001 und 2005 von zehn auf sechs Prozent. Kritiker betonen jedoch, dass die Politik der Transfers die Eigeninitiative der Empfänger untergrabe. Auch die FAO verlangt von den armen Staaten, dass sie nachhaltige Strategien umsetzen. Nur so könne die „Schlacht gegen den Hunger gewonnen werden“, betonte FAO-Generaldirektor Jacques Diouf.
(Tagesspiegel, Januar 2010)
Da stelle ich mir gerade schöne Synergieeffekte vor und fühle mich dabei kannibalisch wohl:
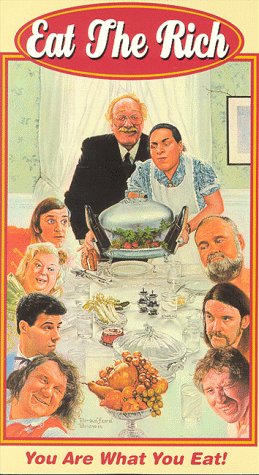
Ach, wenn sich doch nur alle Probleme auf diesem Planeten so leicht lösen liessen.